Sie nennt sich die weltweit größte Urlaubsmesse, die auch fürs Publikum öffnet. Neun Tage dauert die Messe, zwei Wochenenden sind in dieser Ausstellungszeit. An den Wochenenden ist es natürlich sehr voll in den Gängen. Doch auch an einem Werktag braucht es Geduld, bis ein Tourismusexperte Zeit für einen hat. Insgesamt präsentieren sich 90 Länder sowie 360 Regionen.
Wer hier ohne konkretes Ziel die neun großen Messehallen auf und ab schlendert, läuft Gefahr sich zu verlaufen oder kauft vor Begeisterung ein Wohnmobil ;-). Busgroße, mit allem Schnickschnack ausgestattete Wohnmobilheime sind zu bewundern. Auf den Preis schauen wird nicht, es geht ja um Inspiration, Fernwehinfizierung und mobile Freiheit. Auch der Allradjeep mit Aufbau für unwegsames Gelände zieht die Blicke magisch an. Also … wer hier spontan unbeabsichtigt ein Wohnmobil kauft …. Gratulation.
Fotografenliebling war auch das knallrote Gespann – Fiat und Wohnmobil aus dem Museum Hymer aus Bad Waldsee. Angestanden sind die Menschen, um mal schnell ein Foto davon zu machen. Und irritiert blieb der eine oder andere Besucher vor dem Porsche mit dem Fahrradständer stehen.

Fiat und Wohnwagen vom Hymer Museum
Apropos Fahrrad – das wird der Trend dieses Jahr, gerade in Baden-Württemberg. Karl Drais fuhr am 12. Juni 1817 mit seinem Laufrad in Mannheim. Die Laufmaschine gilt als Urform unseres heutigen Fahrrades. Baden-Württemberg feiert das 200jährige Jubiläum mit vielen Aktionen und Veranstaltungen. Es gibt eine Große Landesausstellung zum Jubiläum im Technomuseum in Mannheim.
Mobil sind die Baden-Württemberger. Laut Statistik gibt der Baden-Württemberger 1076 Euro pro Person und Jahr für Urlaub aus, während es deutschlandweit 954 Euro sind. Wer die Halle 6 betritt, in dem die zahlreichen Regionen Baden-Württembergs vorgestellt werden, könnte jedes Wochenende in eine andere Ecke im Ländle reisen. Es ist stets ein Mix aus Kultur, Wandern und Genuss. Ob im romantischen Taubertal oder im Stauferland, auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald usw. Und es gibt Probiererle und was zum Gugga auf den Ausstellungsständen und Showprogramm auf der SWR-Bühne. Der Hallenboden ist grün, das eine natürliche heimelige Stimmung gab. Oberschwaben hat sich mittlerweile als Region einen Namen gemacht – es ist nicht mehr die Region zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee. Tja – da schaff ich auch mit – wenn auch ehrenamtlich. Schwerpunkte sehe ich also für dieses Jahr im Ländle die Fahrradreisen, das Wandern – sei es auf einem der Pilgerwege oder oifach so in der schönen Landschaft unterwegs. Übrigens, die Gruppe mit der Springseilakrobatik erntete viel Beifall.
Ja und sonst? Die östlichen Länder wie Albanien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Slowenien wurden von den Besuchern sehr gut besucht. Albanien ist das diesjährige Partnerland mit Schwerpunkt Camping und Caravaning auf der CMT17. Ein 300 Kilometer langer Adriasandstrand lockt.
Leer war es am Ausstellungsstand Türkei. Die politische Situation lockt die Besucher nicht ins Land. Ein Mitarbeiter am Infostand Griechenlands: „Die Urlauber suchen sich neue Ziele. Türkei wird gemieden, auch Ägypten, Tunesien – es sind die muslimisch geprägten Länder.“ Dies kann er deutlich beobachten.
Kurzum – der Baden-Württemberger bleibt den Krisengebieten fern – doch er bleibt reisewillig und sucht anderweitig das Abenteuer.
Und wo würdest Du gerne mal Urlaub machen?




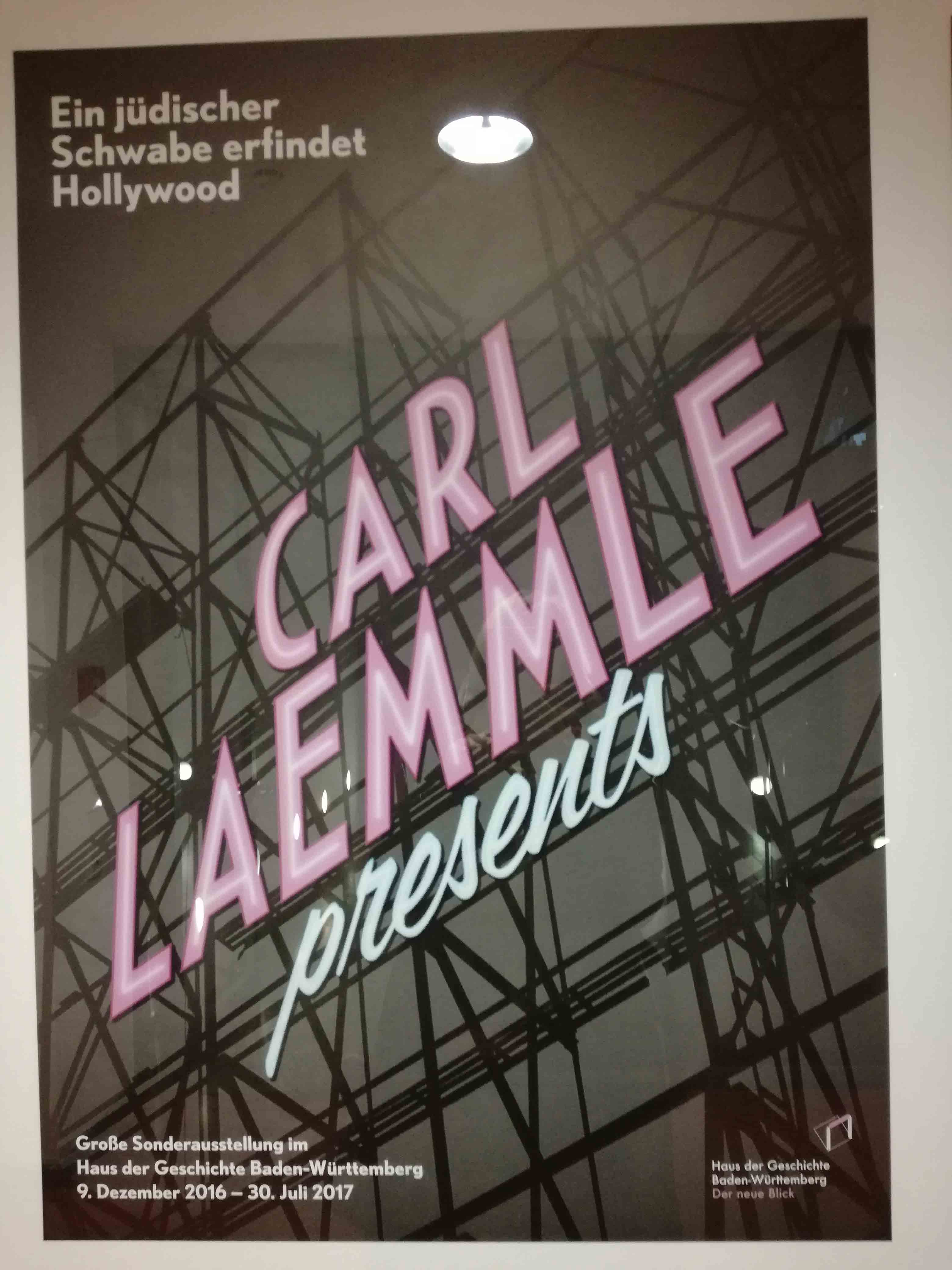
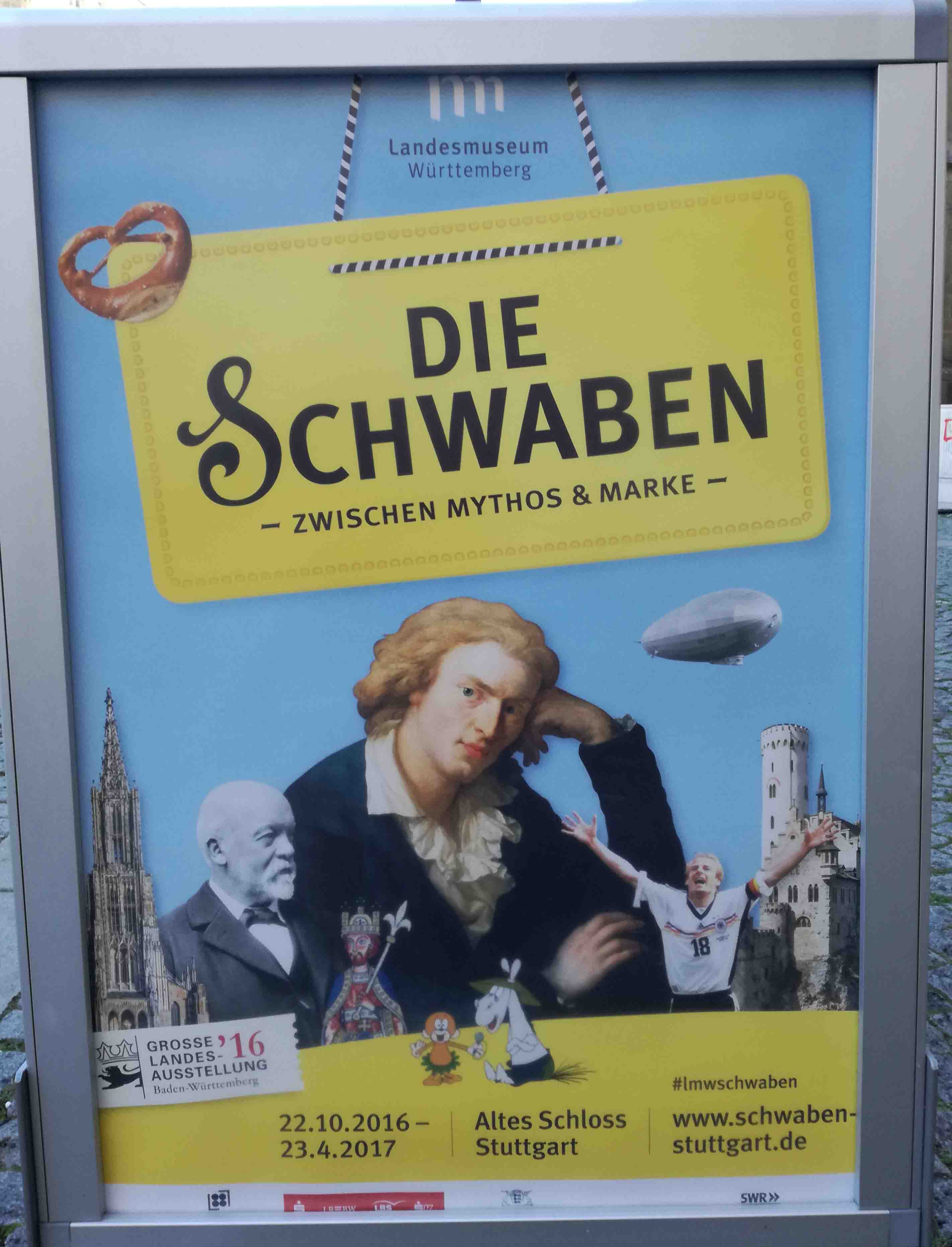







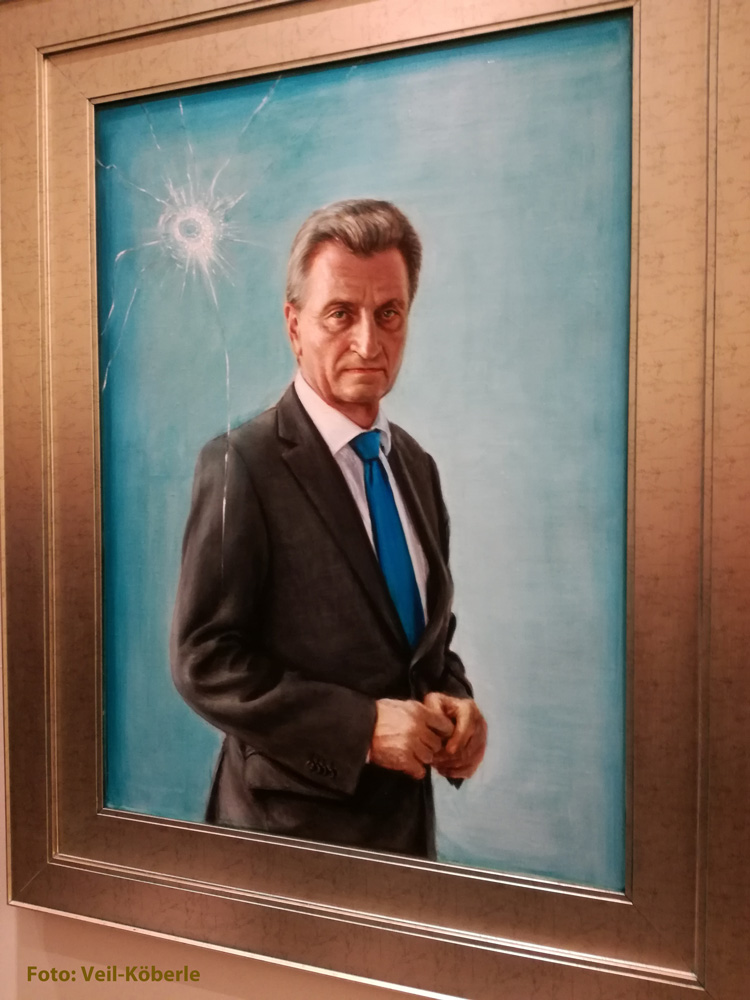

 Früh am Morgen kann es in Oberschwaben nebelig, kalt und mit Geduld wird es sonnig. Die Gräser, Pflanzen, Bäume sind in einen Rauhreif eingekleidet. Wunderschön und faszinierend.
Früh am Morgen kann es in Oberschwaben nebelig, kalt und mit Geduld wird es sonnig. Die Gräser, Pflanzen, Bäume sind in einen Rauhreif eingekleidet. Wunderschön und faszinierend.



