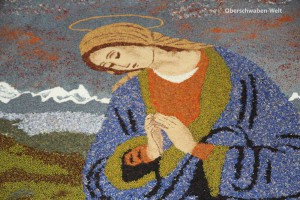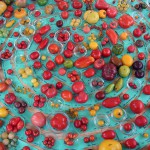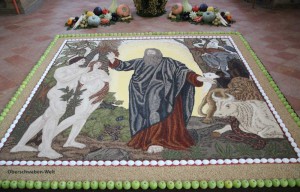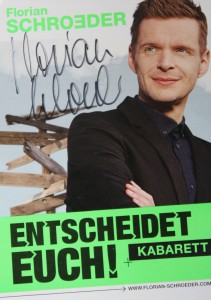Kunst in Oberschwaben
Mit der Kunst ist es ja so eine Sache. Das Genre der Installationen, Medien- und Konzeptkunst, wie es noch bis 12. Oktober 2014 im Museum Villa Rot in Burgrieden gezeigt wird, wird seit den 70er Jahren zu den Kunstarten dazugezählt. Trotzdem: So mancher geht ja nicht hin, weil er Videos grundsätzlich nicht als Kunstmedium anerkennen mag. Schade eigentlich. Sehr schade. In Burgrieden zeigen 16 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern ihre Arbeiten.
Persönlich schaue ich mir Medienkunst oder eine Installation genauso gerne an wie einen guten Film oder Malerei. Und zugegeben, auch ich kann mich fragen: Und was habe ich gesehen? Kann ich was damit anfangen? So ging es auch mir mit dem einen oder anderen Exponat in der Ausstellung. Auf dem Weg nach Hause blinzelte mir allerdings dann doch der Schalk und die Ernsthaftigkeit einzelner Werke hinterher. Manche Arbeiten haben Nebenwirkungen, die eben nicht sofort gleich wirken.
Doch springen wir doch einfach mal rein in die Ausstellung und picken uns das eine oder andere Exponat heraus. Im ersten Raum stehen wir zuerst mal im Dunklen bis wir den Lichtrahmen von Herbert Moser erkennen. Diese Linie als Rahmen an Licht, das den Raum erhellt. Das Licht das am und vom Körper reflektiert wird. Wird man nun Teil vom Rahmen, oder wieso sehe ich etwas, das gar nicht zu greifen ist? Kann ich alles anfassen, was ich sehe. Spüre ich alles, was den Körper berührt?
Raumgreifend ist die Installation von Nándor Angstenberger. Mobilar aus der Villa Rot wurde umgarnt, eingesponnen mit blauen (?) Wollfäden. Es ist wie ein Wimmelbild, wenn den Fäden gefolgt wird. Hier noch ein Zugseil, da noch eine Webfläche – ach Wattestäbchen sind auch noch eingearbeitet. Die Historie der Villa Rot ist lesenswert und wenn die Möbel sprechen könnten, was würden sie wohl erzählen. Möbel, die spinnwebenhaft aus der Vergänglichkeit ins Blaue geholt werden?
Bleiben wir bei Möbeln. Thomas Locher arbeitete ebenfalls mit Möbeln, in die Wörter geordnet eingefräst wurden. Schlichte, schnörkellose Möbel wurden mit schlichten schnörkellosen Worten codiert. Der Logik, die Selbstaussagen der Wörter apellieren an das Befinden des Nutzers, Lesers, des Möbelstückes. Es ist wie ein stiller sachlicher Dialog, eine Geschichte zwischen Möbel und Betrachter.

Tuer auf und zu – Pressefoto Museum Villa Rot
Im nächsten Raum geht es ebenfalls um die Kommunikation. Zwei Filme von dem Künstlerduo Johannes Brunner und Raimund Ritz. An die gegenüberliegende Wand wird jeweils eine Tür mit einer Person projeziert. Eigentlich könnten sich die Personen, ein Mann und eine Frau, gegenseitig anschauen. Sie schauen auch in die jeweilige Richtung. Alarmierend. Als Betrachter steht man in der Mitte und schaut diesen beiden Personen zu, wie sie immer auf des anderen Tür schauen. Wie sie des anderen Kontakt suchen, doch einer schaut immer gerade in dem Moment woanders hin. Sie treffen sich nicht, kein Augenkontakt. Diese Videoinstallation veranschaulicht sehr genau, wie schwierig es doch mittlerweile ist, in Kontakt zu kommen. Wie seltsam es sich anfühlt, anderen am Vorbeileben zuzuschauen.
Ebenfalls sehenswert und berührend sind die Arbeiten von Albrecht Schäfer. Der Baum, der in sich verdreht in der Landschaft steht. An einer vielbefahrenen Landstraße stehen Bäume, scheinbar unbedeutend, auf den zweiten Blick sind auch sie Unikate. Während die Autos schnell vorbeifahren, fährt die beobachtende Kamera den Weg viel langsamer ab, fast in Zeitlupe. Mittlerweile mein Lieblingswerk in der Ausstellung, weil es meines Erachtens Oberschwaben treffend beschreibt. Zeitraffer und Zeitlupe in einem. Das Leben zieht zügig vorbei und mit dem zweiten Blick läuft es verlangsamt, sogar in der selbstgewählten Langsamkeit. Dabei zeigt der Hintergrund noch die Ruhephase des Waldes. Schäfers feinsinnige Beobachtungsgabe trifft.
Zuguter Letzt sei noch das Video von Konstantin Felker erwähnt, der jüngste Künstler im Bunde. In dem Film fährt er von seinem wohlhabenden Heimatort Biberach mit dem Schubkarren voller Münzgeld über die Feld- und Waldwege, quert Landstraßen, schiebt den Karren nach Burgrieden in den ersten Stock des Museums. Bei aller Schlichtheit und dem nichtspannenden Gedanken: Das hätte ja jeder tun können. Es empfiehlt sich ein Nachdenken. Das um was geht es, woher, wohin, wo liegt die Spannung. Der ausgeleerte Schubkarren steht im Museum, das Münzgeld liegt auf dem Boden. Das Video ist jung, oberschwäbisch spitzbübisch mit einem Anflug von Kabarett, einfach minimalistisch barock.
Meine Interpretation:
Die bekannte reiche Stadt Biberach hat Bewohner. Diese Menschen haben Talente. Auch wenn der Stadt Reichtum attestiert wird, sind es deshalb nicht alle Menschen. Manche haben Talente, die nicht sehr wertgeschätzt werden. Ähnlich dem roten Münzgeld. Welch Aufwand ist es daher sein Talent auf zwei Füßen mit Münzgeld in einem Schubkarren zu transportieren.
Der Schubkarrenschieber schiebt sein Hab und Gut, das oft im Reichtum seine Wertigkeit verliert, persönlich über Brücken, über Wald- und Feldwege nach Burgrieden. Burgrieden auch nicht gerade der Mittelpunkt der Weltgeschichte. Dort ungeachtet des feinen Museums wird die gewichtige Karre eigenhändig die Treppen hochgezogen. Das eine oder andere Münzgeld fällt herunter. Verloren auf dem Weg? Oder Wegegeld? Und mit einem Schwung wird das Münzgeld in dem kleinen Ausstellungsraum ausgeschüttet. Hach, da liegt es das Talent, sein Reichtum und die Wertigkeit des Daseins. Jeder bereichert sich daran, still und unbemerkt.
Anfahrt zum Museum Villa Rot in Burgrieden
Link auf Googlemaps zum Museum Villa Rot in Burgrieden
Bühnenwechsel. Zurück zu dem Künstlerduo Johannes Brunner und Raimund Ritz, die in der Villa Rot mit den gegenüberliegenden Türvideos die Barrieren der Kommunikation aufzeigten. Das Künstlerduo wird eine Klangskuptur im öffentlichen Raum, genauer gesagt in der Stadtpfarrkirche Biberach, präsentieren. Die Beiden finden, dass öffentliche Orte spannend sind, weil die Zuschauer auf Veränderungen oder Zweckentfremdung eines öffentichen Ortes überraschend reagieren.
Daher wird am Sonntag, 28. September, 17 Uhr in der Simultaneumkirche in Biberach an der Riss, der Stadtpfarrkirche am Marktplatz, eine Messe für Donner, Regen, Sprache und Gesang angeboten.
Ort: Stadtpfarrkirche St. Martin, Am Kirchplatz, 88400 Biberach
Auszug aus der Pressemitteilung Museum Villa Rot Burgrieden:
Im Rahmen seiner aktuellen Ausstellung Kunst Oberschwaben 20. Jahrhundert – 1970 bis heute präsentiert das Museum Villa Rot in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach die zeitgenössische Messe Missa Tempestatis des in Oberschwaben aufgewachsenen und heute in München lebenden Künstlerduos Johannes Brunner und Raimund Ritz.
Mit ihrer Klangskulptur nehmen der Bildhauer Johannes Brunner und der Komponist Raimund Ritz Bezug auf die zentrale liturgische Form des katholischen Gottesdienstes.
Die Texte der Liturgie wurden übertragen und um weitere alte, religiöse Textfragmente ergänzt. Sie werden gesprochen und gesungen von zwölf Sprechern und Sängern, Sopran, Bass und Counter-Tenor. Keine konzertante Aufführung, sondern unsichtbare Technik erwartet die Besucher. Der Klang wandert, die Musik dringt von allen Seiten auf den Hörer ein und verwandelt den architektonischen Kirchenraum in einen Klangraum.
Johannes Brunner und Raimund Ritz experimentieren mit Beschleunigung und Dehnung des Klangs, mit seiner Bewegung zwischen Nähe und Ferne, seiner Zersplitterung und Synthese, seiner Lautstärke und Stille, und lassen ein einzigartiges Klangerlebnis entstehen.
Die Aufführung findet in einer Kooperation des Museums Villa Rot mit dem Kunstverein Keck e.V. sowie der Evangelischen und Katholischen Gesamtkirchengemeinde in der paritätischen Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach statt.